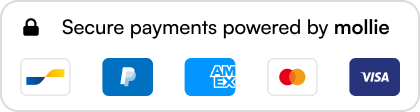Dieses Medikament, das wirklich jeden heilt?
Entdeckt in den 1970er Jahren, Ivermectin ist ein revolutionäres Antiparasitikum, das bei Menschen und Tieren eingesetzt wird. Das Molekül, das 2015 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, wird zur Behandlung von Krankheiten wie Flussblindheit, Krätze und bestimmten parasitären Darmerkrankungen eingesetzt.
Auch in der Veterinärmedizin ist die Anwendung weit verbreitet: als Entwurmungsmittel für Pferde, als Antiparasitikum für Hunde oder Rinder. Dies hat zu der falschen Annahme geführt, dass dieselben Produkte in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden könnten.
Diese Verwirrung erreichte während der COVID-19-Pandemie einen Höhepunkt, als veterinärmedizinische Formulierungen oft ohne ärztliche Aufsicht an Menschen angewendet wurden, was manchmal schwerwiegende Folgen hatte. Es wurde von Vergiftungen, auch neurologischer Art, nach Überdosierungen oder Arzneimittelwechselwirkungen (mit CYP3A4/P-gp-Inhibitoren wie Ritonavir oder Ketoconazol) berichtet.
In dieser Artikelserie erklären wir, warum Ivermectin trotz eines gemeinsamen Moleküls nicht als universelles und artenübergreifendes Produkt angesehen werden kann. Formulierung, Dosierung, Stoffwechsel, Sicherheit: Bei der Anwendung in der Veterinärmedizin und beim Menschen gibt es erhebliche Unterschiede.
Ein Molekül aus der Erde: Die unwahrscheinliche Geschichte von Ivermectin
Die Geschichte von Ivermectin Die Forschung begann 1973, als der japanische Mikrobiologe Satoshi Ōmura ein Bodenbakterium der Gattung Streptomyces isolierte. Dieser Stamm produziert natürliche Verbindungen mit starken antiparasitären Eigenschaften. Eine dieser Verbindungen, Avermectin, wurde später von Dr. William Campbell und seinem Team chemisch modifiziert, um eine stabilere und wirksamere Version zu schaffen: Ivermectin.
Das Molekül wurde zunächst an Tieren getestet und zeigte eine außergewöhnliche Wirksamkeit gegen Darmwürmer, Läuse und Milben. In den 1980er Jahren wurde Ivermectin zu einer Standardbehandlung in der Veterinärmedizin.
Seine Wirksamkeit gegen menschliche Parasiten wurde schnell bewiesen, insbesondere im Kampf gegen Onchozerkose (Flussblindheit) und Strongyloidose. Es wurde im Rahmen des Mectizan-Programms kostenlos in afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern verteilt und rettete Millionen von Menschenleben.
Im Jahr 2015 erhielten Satoshi Ōmura und William Campbell den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Doch über diesen Erfolg hinaus ist der breiten Öffentlichkeit eine grundlegende Tatsache unbekannt: Die Anwendung bei Mensch und Tier ist nicht austauschbar. Dies wird durch die erheblichen Unterschiede in Formulierung, Verträglichkeit und Sicherheit belegt.
Dasselbe Molekül, sehr unterschiedliche Verwendungen: Die wahren Unterschiede verstehen
Ivermectin ist ein einzigartiger Wirkstoff, dessen Anwendung sich jedoch grundlegend unterscheidet, je nachdem, ob er für Menschen oder Tiere bestimmt ist. Diese Unterscheidung beruht nicht nur auf regulatorischen oder kommerziellen Aspekten, sondern entspricht spezifischen medizinischen, biologischen und toxikologischen Erfordernissen.
Dosierungen ohne gemeinsames Maß
Eine der auffälligsten Diskrepanzen betrifft die Dosierung. Ein erwachsener Mensch erhält typischerweise zwischen 0,2 und 0,4 mg Ivermectin pro Kilogramm Körpergewicht. Große Tiere – Pferde und Rinder – erhalten dagegen möglicherweise deutlich höhere Dosen, angepasst an ihre Körpermasse und physiologische Verträglichkeit.
Eine einfache Rechnung verdeutlicht das Gefahrenpotenzial: Eine Ivermectin-Paste für ein 500 kg schweres Pferd enthält eine enorme Menge des Wirkstoffs. Bei der Anwendung am Menschen kann es bereits bei geringen Mengen zu einer Überdosierung kommen, die Übelkeit, Schwindel, neurologische Störungen und im Extremfall sogar ein Koma zur Folge haben kann.
Inkompatible Formulierungen
Neben der Dosierung variiert auch die Zusammensetzung der Produkte selbst. Tierarzneimittel enthalten oft Hilfsstoffe – Lösungsmittel, Verdickungsmittel, Aromastoffe, Konservierungsmittel –, die in der Humanmedizin nicht zugelassen sind. Diese Substanzen sind zwar für Tiere harmlos, können für Menschen jedoch schlecht verträglich oder sogar giftig sein.
Auch die Darreichungsformen variieren: Injektionslösungen für Rinder, orale Pasten für Pferde, Tropfen für Hunde usw. Diese Darreichungsformen wurden nie an Menschen getestet und erfüllen nicht die in der Humanmedizin erforderlichen Sicherheits- und Bioverfügbarkeitsstandards.
Speziesspezifische Pharmakokinetik
Der Ivermectin-Stoffwechsel variiert zwischen den Tierarten. Was von einem Tier gut aufgenommen oder schnell ausgeschieden wird, kann sich beim Menschen anreichern. Umgekehrt kann eine für den Menschen sichere Dosierung bei Tieren unwirksam oder gefährlich sein. Diese Unterschiede zwischen den Arten erklären, warum die Kreuzmedikation riskant, ja sogar unverantwortlich ist.
Trotz eines gemeinsamen Moleküls sind veterinärmedizinische Anwendungen und medizinisches Ivermectin basieren auf sehr unterschiedlichen Logiken, die auf präzisen wissenschaftlichen Daten beruhen. Hinter der scheinbaren Einfachheit des Produkts verbirgt sich tatsächlich eine pharmakologische Komplexität, die nicht unterschätzt werden sollte.
Warum Sie niemals eine Tierversion bei sich selbst anwenden sollten
Die Anwendung von Ivermectin in tierärztlichen Darreichungsformen beim Menschen ist weder harmlos noch ohne Folgen. Trotz des Vorhandenseins eines identischen Wirkstoffs machen die Unterschiede in Konzentration, galenischer Form, biologischer Verträglichkeit und Rechtsstatus diese Praxis gefährlich, unwirksam und illegal.
Unangemessene und riskante Dosen
Bei Erwachsenen beträgt die therapeutische Standarddosis von Ivermectin 0,2 mg/kg. In bestimmten schweren Fällen (Krätzekrätze, disseminierte Strongyloidiasis) kann sie auf 0,4 mg/kg ansteigen. Bei einer 70 kg schweren Person entspricht dies 14 bis 28 mg.
Eine typische Veterinärspritze (orale Paste für Pferde) mit einer Dosierung von 6–18 mg/g in einem Volumen von 6 g enthält jedoch zwischen 36 und 108 mg Ivermectin – das Drei- bis Achtfache der für einen erwachsenen Menschen vorgesehenen Höchstdosis. Bei solchen Dosen besteht für den Patienten das Risiko einer akuten Überdosierung, insbesondere ohne ärztliche Aufsicht.
Gut dokumentierte neurologische Toxizität
Bei der Einnahme von Dosen, die das Zehnfache der therapeutischen Dosis übersteigen, oder bei Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln werden schwere Nebenwirkungen berichtet. Zu den Symptomen gehören:
- Ataxia,
- geistige Verwirrung,
- extreme Schläfrigkeit,
- Koma,
- Bradykardie und
- niedriger Blutdruck, verbunden mit einer Depression des zentralen Nervensystems.
In einigen Regionen Afrikas (Zentralafrikanische Republik, Kamerun) wurden auch bei Standarddosen Fälle schwerer Enzephalopathie bei mit Loa loa infizierten Patienten beschrieben: Die massive Zerstörung der Mikrofilarien im zentralen Nervensystem kann zu Krämpfen, Koma und Tod führen. Deshalb ist in den betroffenen Gebieten vor jeder Verabreichung ein Screening auf Mikrofilariämie unerlässlich.
Kritische Arzneimittelwechselwirkungen
Ivermectin wird hauptsächlich durch Cytochrom CYP3A4 metabolisiert und durch P-Glykoprotein (P-gp) transportiert. Die Hemmung dieser Stoffwechselwege führt zu gefährlich erhöhten Plasmakonzentrationen.
Starke Inhibitoren:
- Ketoconazol,
- Ritonavir,
- Clarithromycin,
- Grapefruitsaft.
Leistungsstarke Induktoren:
- Rifampicin,
- Carbamazepin,
- Phenytoin – verringert die Wirksamkeit des Arzneimittels.
Darüber hinaus kann Ivermectin die gerinnungshemmende Wirkung verstärken: Bei mit Warfarin behandelten Patienten wurden Fälle von erhöhtem INR-Wert beobachtet, die eine engmaschige Überwachung erfordern.
Hilfsstoffe, die nicht für den Menschen bestimmt sind
Veterinärmedizinische Formulierungen enthalten häufig Hilfsstoffe, die für den Menschen giftig sind:
- Orale Pasten sind aromatisiert für Pferde,
- Injektions- oder Aufgusslösungen (Anwendung auf der Haut bei Rindern) enthalten Isopropanol, Butandiol und andere Lösungsmittel, die für die Anwendung beim Menschen verboten sind.
Diese Präparate werden in einer Dosierung von 10–20 mg/ml verabreicht und manchmal versehentlich oral oder transkutan aufgenommen.
Die Bioverfügbarkeit, Stabilität und Verträglichkeit dieser Formen wurde beim Menschen nie untersucht. Die Off-Label-Verabreichung solcher Produkte stellt ein unnötiges Risiko dar.
Illegale Nutzung gemäß dem Gesetz
In Frankreich ist gemäß Artikel L.5121-8 des Gesetzbuchs über das öffentliche Gesundheitswesen die unbefugte Verwendung von Tierarzneimitteln für den menschlichen Gebrauch verboten. Auch in Belgien verbietet der Königliche Erlass vom 14.12.2006 den Besitz und die Verschreibung von Tierarzneimitteln für den menschlichen Gebrauch. Verstöße können zu Geldstrafen von bis zu 75.000 Euro oder sogar zu einer strafrechtlichen Verfolgung wegen illegalen Inverkehrbringens führen.
Der Online-Import dieser Produkte, selbst für den Eigenbedarf, stellt eine Zollstraftat dar, die mit einer Beschlagnahme an der Grenze und Verwaltungssanktionen verbunden ist.
Sichere und überwachte menschliche Alternativen
Menschliche Formen von Ivermectin sind unter ärztlicher Aufsicht erhältlich:
- 3 mg und 6 mg Tabletten (Generikum oder Marken-Stromectol),
- 1 % Creme (Soolantra) gegen Rosazea,
- verpackt nach GMP-Standards,
- durch klinische Studien validiert und der Pharmakovigilanz unterworfen.
Diese Produkte ermöglichen eine wirksame, dokumentierte und sichere Anwendung, im Gegensatz zu veterinärmedizinischen Formulierungen, die unvorhersehbar und potenziell gefährlich sind.
Ein Medikament von gestern und morgen? Chancen und Grenzen von Ivermectin
Dank seiner Wirksamkeit gegen Parasiten hat Ivermectin in Afrika, Asien und Lateinamerika Millionen von Leben gerettet.Seine Wirkung ist so groß, dass es manchmal als „antiparasitäres Penicillin“ bezeichnet wird. Aber kann es über seine klassischen Indikationen hinausgehen? Und wie sieht seine Zukunft in der Humanmedizin aus?
Forschung außerhalb der Parasitologie: zwischen Hoffnung und Vorsicht
In den letzten Jahren wurden die antiviralen, entzündungshemmenden und sogar krebshemmenden Eigenschaften von Ivermectin erforscht. In-vitro-Studien zeigten eine Hemmung der Replikation bestimmter Viren (Zika, Dengue, SARS-CoV-2), allerdings sind die wirksamen Laborkonzentrationen weit höher als die beim Menschen sicher erreichbaren.
Große randomisierte Studien wie TOGETHER (2022) und ACTIV-6 (2023) haben Ivermectin gegen COVID-19Ergebnis: kein signifikanter klinischer Nutzen. Diese Daten veranlassten die WHO und die EMA, von der Verwendung in diesem Zusammenhang abzuraten, außer in Forschungsprotokollen.
Die krebshemmenden und neuroprotektiven Wirkungen sind noch experimentell und nicht klinisch validiert. Die beobachteten Mechanismen (Modulation des Wnt-Signalwegs, Hemmung von Ionenkanälen, Regulierung der Autophagie) sind vielversprechend, aber noch weit von einer konkreten therapeutischen Anwendung entfernt.
Gezielte, begründete und überwachte Anwendung
Die Zukunft von Ivermectin liegt nicht in seiner weitverbreiteten oder missbräuchlichen Anwendung, sondern in seiner intelligenten und präzisen Integration in validierte Protokolle. Als Antiparasitikum bleibt es in bestimmten Regionen der Welt unersetzlich. Als Kandidatenmolekül für andere Anwendungen muss es denselben wissenschaftlichen Weg wie jedes andere Medikament durchlaufen: strenge Tests, unabhängige Bewertungen, strenge regulatorische Rahmenbedingungen.
Nützliche Referenzen und offizielle Quellen
- Beratung der FAAG
- Vollständige Informationen zu Ivermectin (Indikationen, Dosierung, Wechselwirkungen)
- Klinische Studie TOGETHER (NEJM 2022) – Ivermectin und COVID-19: Kein Nutzen nachgewiesen
- Gemeinsame Position der AMA, ASHP und APhA gegen die Off-Label-Anwendung von Ivermectin:
- FDA-Monographie: Wechselwirkungen mit CYP3A4/P gp, Nahrungsmitteln, Antikoagulanzien (Warfarin)
- Warnung in der Loa-Loa-Zone: Risiko einer Enzephalopathie auch bei Standarddosen