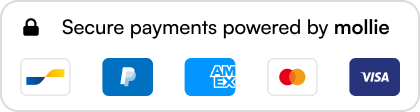In der kollektiven Vorstellung scheinen Humanmedizin und Veterinärmedizin zwei sehr unterschiedliche Wege zu verfolgen. Die moderne Geschichte der Pharmakologie zeigt jedoch, dass diese Trennung viel durchlässiger ist, als es den Anschein macht. Einige Medikamente, die ursprünglich zur Behandlung von Tieren entwickelt wurden, haben sich als so wirksam und sicher erwiesen, dass sie später für die Anwendung beim Menschen angepasst wurden.
Dieses Phänomen ist nicht trivial: Es spiegelt eine gemeinsame wissenschaftliche Logik wider. Ob Parasiten, Bakterien oder gemeinsame zelluläre Mechanismen – Tier- und Menschenarten haben viele gemeinsame biologische Ziele, wodurch bestimmte Moleküle zwischen den beiden Fachgebieten „übertragbar“ sind.
Zu den emblematischsten Beispielen zählen Ivermectin (Stromectol), ein Molekül, das zunächst bei Tieren zur Bekämpfung von Parasitenbefall eingesetzt wurde, entwickelte sich später zu einem wichtigen Instrument globaler Gesundheitskampagnen. Doch es ist nicht das einzige. Mehrere Antiparasitäre Medikamente, Antimykotika oder sogar einige Antibiotika haben einen ähnlichen Weg von der Veterinärmedizin in die Humanmedizin eingeschlagen.
Anhand von Beispielen und Analysen wird gezeigt, wie diese Übergänge möglich sind, in welchen Fällen sie gerechtfertigt sind und warum sie streng geregelt werden müssen. Dies unterstreicht auch die Logik des „One Health“-Konzepts: ein integrierter Ansatz für die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt.
Ivermectin: ein Molekül mit doppelter Funktion
Vom Bauernhof zur globalen öffentlichen Gesundheit
Ivermectin ist wohl das beste Beispiel für ein Tierarzneimittel, das zu einer tragenden Säule der öffentlichen Gesundheit geworden ist. Dieses Molekül wurde Ende der 1970er Jahre vom japanischen Mikrobiologen Satoshi Ōmura und dem amerikanischen Forscher William Campbell (Nobelpreis für Medizin 2015) entdeckt und zunächst zur Behandlung von Parasiten bei Tieren wie Rindern, Pferden, Hunden und Schafen entwickelt.
Seine spektakuläre Wirksamkeit gegen Darmwürmer, Milben und andere äußere Parasiten machte es schnell zu einem Standardmittel in der Veterinärmedizin. Ivermectin ist wenig toxisch, einfach zu verabreichen, stabil und bereits bei niedrigen Dosen hochwirksam. Damit erfüllte es viele Voraussetzungen für eine breite Anwendung – auch über das Tierreich hinaus.
Anfang der 1980er Jahre zeigten klinische Studien, dass Ivermectin auch beim Menschen wirksam war, insbesondere gegen Onchozerkose (oder „Flussblindheit“), eine parasitäre Erkrankung Diese Krankheit wurde in mehreren Teilen Afrikas durch Fliegen übertragen und war damals eine der Hauptursachen für vermeidbare Blindheit, von der Millionen Menschen betroffen waren.
1987 startete Merck das Mectizan®-Programm, eine bahnbrechende Initiative, die in Zusammenarbeit mit der WHO, UNICEF und zahlreichen NGOs allen betroffenen Ländern kostenlos Ivermectin zur Verfügung stellte. Seit ihrer Einführung konnte mit dieser Strategie über eine Milliarde Menschen behandelt und die Prävalenz mehrerer vernachlässigter Tropenkrankheiten drastisch reduziert werden.
Ivermectin wird derzeit verwendet in:
- Behandlung von Onchozerkose und lymphatischer Filariose;
- Prävention schwerer Krätze bei Risikogruppen;
- einige Fälle von Strongyloidose.
Internationale Anerkennung
Dieser Erfolg gilt als eine der größten Errungenschaften im Bereich der öffentlichen Gesundheit im 20. Jahrhundert. Er zeigt, wie ein gut verwaltetes Veterinärmolekül zu einem unverzichtbaren Instrument im Kampf gegen menschliche Krankheiten von den großen traditionellen Pharmakonzernen weitgehend ignoriert.
Doch die Ivermectin-Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Sie gibt Anlass zum Nachdenken: Welche Kriterien erlauben die Anwendung eines Tierarzneimittels am Menschen? Welche Risiken birgt eine solche Übertragung? Und wie können wir Missbrauch, wie er kürzlich während der COVID-19-Pandemie beobachtet wurde, vermeiden?
Dies werden wir im nächsten Kapitel untersuchen.
Unter welchen Voraussetzungen ist die Adaption eines Tierarzneimittels an den Menschen möglich?
Der Übergang eines Arzneimittels aus der Veterinärmedizin in die Humanmedizin erfolgt nicht leichtfertig. Es basiert auf strengen wissenschaftlichen Kriterien, da die Anforderungen an Sicherheit und Wirksamkeit je nach Tierart, Stoffwechsel, Absorptionswegen und Empfindlichkeit gegenüber Wirkstoffen unterschiedlich sind.
Verträglichkeit und pharmakologische Sicherheit
Um eine Verwendung am Menschen in Betracht zu ziehen, muss ein Veterinärmolekül zunächst Folgendes nachweisen:
- sehr geringe Toxizität für den Menschen bei wirksamen Dosen;
- stabile und vorhersehbare Bioverfügbarkeit (insbesondere bei oraler Verabreichung);
- das Fehlen einer langfristigen Anreicherung im menschlichen Gewebe.
Beispielsweise hat Ivermectin, obwohl es für Tiere entwickelt wurde, eine sehr große therapeutische Breite beim Menschen gezeigt – ein entscheidender Punkt für seine klinische Entwicklung.
Galenische Anpassung und präzise Dosierung
Veterinärmedizinische Formulierungen sind nie direkt auf den Menschen übertragbar. Sie können enthalten:
- Hilfsstoffe, die für den menschlichen Körper nicht geeignet sind,
- zu hohe Konzentrationen,
- Konservierungsstoffe oder Lösungsmittel, die in der Humanmedizin verboten sind.
Daher kann eine für Rinder bestimmte injizierbare Form oder eine Tablette für Hunde gefährlich oder sogar giftig sein, wenn sie vom Menschen so eingenommen werden.
Daher müssen Labore das Produkt entsprechend den pharmazeutischen Standards für Menschen neu formulieren und dabei Konzentration, Reinheit und Stabilität anpassen, um eine sichere und reproduzierbare Verwendung zu gewährleisten.
Kenntnis des Wirkmechanismus
Ein weiteres wesentliches Kriterium ist ein klares Verständnis der molekularen Wirkungsweise. Medikamente wie Ivermectin zielen auf spezifische Ionenkanäle ab, die in den Nerven von Parasiten vorhanden sind, beim Menschen jedoch fehlen oder anders aufgebaut sind. Dies erklärt ihre hohe Selektivität, d. h. ihre Fähigkeit, Parasiten abzutöten, ohne den menschlichen Wirt zu beeinträchtigen.
In Fällen, in denen molekulare Ziele bei verschiedenen Arten gleich oder ähnlich sind, steigt das Risiko von Nebenwirkungen, und es ist Vorsicht geboten.
Validierung durch Gesundheitsbehörden
Schließlich bedarf jede Anwendung am Menschen einer strengen behördlichen Genehmigung:
- klinische Studien am Menschen (Phasen I bis III),
- Bewertung durch Behörden wie die EMA (Europa), die FDA (USA) oder die WHO für den Massengebrauch,
- Überwachung nach der Markteinführung (Pharmakovigilanz).
Ohne diese Schritte kann und sollte einem Patienten kein Tierarzneimittel verschrieben werden.
Weitere Beispiele für Moleküle, die aus der Tiermedizin in die Humanmedizin übergegangen sind
Ivermectin ist zwar das prägendste Beispiel für ein Tierarzneimittel, das sich zu einem wichtigen Instrument der öffentlichen Gesundheit entwickelt hat, doch es ist kein Einzelfall. Mehrere ursprünglich für Tiere entwickelte Moleküle wurden nach strenger Validierung für die Humanmedizin adaptiert.
Albendazol und Praziquantel
Diese beiden Medikamente werden häufig eingesetzt in die Behandlung von parasitären Infektionen Bei Tieren wurden sie eingesetzt, bevor sie in vielen tropischen Ländern in die Strategien zur Bekämpfung von Helminthiasis beim Menschen integriert wurden. Heute gehören sie zum Arsenal der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Massenbehandlungsprogramme, insbesondere gegen Askariasis, Hakenwürmer und Bilharziose.
Aufgrund ihrer Wirksamkeit, guten Verträglichkeit und geringen Kosten sind sie das Mittel der Wahl für groß angelegte Kampagnen, insbesondere in ländlichen Gebieten mit geringen Ressourcen.
Liposomales Amphotericin B
Zunächst an Tiermodellen getestet zur Behandlung Pilzinfektionen Dieses Molekül wurde später für den Menschen adaptiert, insbesondere in seiner liposomalen Form, die besser verträglich ist. Es gilt heute als Referenztherapie für die viszerale Leishmaniose, eine potenziell tödliche parasitäre Erkrankung.
Veterinär-Antimikrobiotika
Einige Antibiotikaklassen wurden zunächst an Tieren entwickelt, bevor sie im menschlichen Bereich erprobt wurden, insbesondere im Rahmen der Forschung zu resistenter Tuberkulose oder bestimmten neu auftretenden Zoonosen. Moleküle wie Tiamulin und Valnemulin werden in diesem Zusammenhang untersucht, sind jedoch noch nicht für die Anwendung am Menschen zugelassen.
Der „One Health“-Ansatz als Treiber des Transfers
Diese Beispiele veranschaulichen einen wachsenden Trend: Die Gesundheit von Tieren wird als wertvolle Quelle therapeutischer Innovationen für den Menschen betrachtet. Das Konzept der „Eine Gesundheit“ – eine gemeinsame Gesundheit für Mensch, Tier und Umwelt – trägt dazu bei, Barrieren zwischen den Disziplinen abzubauen und die Zusammenarbeit bei der Suche nach neuen Lösungen, auch medizinischen, zu fördern.
Grenzen, Risiken und Exzesse: Wenn die Verwendung in der Veterinärmedizin gefährlich wird
Obwohl einige veterinärmedizinische Moleküle erfolgreich an die Humanmedizin angepasst wurden, bedeutet dies nicht, dass dieser Transfer automatisch oder risikolos erfolgt. Der Missbrauch oder die unkontrollierte Anwendung von Tierarzneimitteln kann sowohl für einzelne als auch für die gesamte Bevölkerung eine echte Gefahr darstellen.
Selbstmedikation und Missbrauch: der Fall Ivermectin während der Pandemie
Das auffälligste Beispiel ist nach wie vor Ivermectin während der COVID-19-Pandemie. Nach der Veröffentlichung vorläufiger In-vitro-Daten (Labordaten), die auf eine mögliche antivirale Wirkung hindeuteten, wurde das Medikament in den sozialen Medien massiv beworben, ohne dass es solide klinische Beweise gab. Die Folge:
- Viele Menschen haben Veterinärpräparate (für Pferde oder Rinder) gekauft, die in einigen Ländern rezeptfrei erhältlich sind.
- Es wurden Fälle schwerer Vergiftungen mit neurologischen, verdauungsfördernden oder kardialen Nebenwirkungen gemeldet.
- Gesundheitsbehörden wie die ANSM, die WHO und die FDA mussten die Menschen daran erinnern, dass Ivermectin nicht zur Vorbeugung oder Behandlung von COVID-19 zugelassen ist, außer im Rahmen kontrollierter klinischer Studien.
Dieser Vorfall verdeutlichte die Risiken einer unbeaufsichtigten Überweisung, die aus Dringlichkeit oder aufgrund von Fehlinformationen erfolgt.
Für Menschen ungeeignete Formulierungen
Tierarzneimittel können enthalten:
- Hilfsstoffe, die die menschliche Schleimhaut reizen,
- zu hohe Konzentrationen (für mehrere hundert Kilo schwere Tiere),
- oder Wirkstoffe, deren Bioverfügbarkeit je nach Tierart unterschiedlich ist.
Ihre direkte Anwendung beim Menschen ohne Neuformulierung kann daher zu unbeabsichtigter Überdosierung, unvorhergesehenen Wechselwirkungen oder toxischen Reaktionen führen.
Probleme der öffentlichen Gesundheit: Kreuzresistenz
Der übermäßige oder unkontrollierte Einsatz von Veterinärpräparaten kann zudem kollektive Auswirkungen haben. Bestimmte Antibiotika-Familien können bei übermäßiger Anwendung bei Tieren die Entstehung bakterieller Resistenzen fördern, die auf den Menschen übertragbar sind – ein Phänomen, das in der intensiven Tierhaltung bereits gut dokumentiert ist. Dies schwächt die Wirksamkeit künftiger Behandlungen beim Menschen.
Ein strategisches Instrument im globalen öffentlichen Gesundheitswesen
Bei richtiger Bewertung, Neuformulierung und Regulierung werden bestimmte Tierarzneimittel zu wichtigen Säulen der öffentlichen Gesundheitspolitik, insbesondere in ressourcenarmen Regionen. Ihre Wirksamkeit, ihre geringen Kosten und ihre Stabilität machen sie zu idealen Kandidaten für Massenbehandlungskampagnen.
Das Beispiel Ivermectin und der Kampf gegen Onchozerkose
Wie bereits erwähnt, hat sich Ivermectin im Kampf gegen Onchozerkose (Flussblindheit) und lymphatische Filariose weltweit als Erfolgsgeschichte erwiesen. Dank der massiven und nachhaltigen Medikamentenspende von Merck im Rahmen des Mectizan®-Programms konnten Millionen von Menschen in ländlichen Gebieten Afrikas, Lateinamerikas und Asiens von einer regelmäßigen Behandlung profitieren. Das Ergebnis:
- drastische Reduzierung der Blindheitsfälle;
- Unterbrechung der Übertragung in mehreren Gebieten;
- deutliche Verbesserung der Lebensqualität in bisher vernachlässigten Regionen.
Ivermectin steht seit mehreren Jahren sogar auf der WHO-Liste der unentbehrlichen Arzneimittel, eine offizielle Anerkennung seiner strategischen Bedeutung.
Zugänglichkeit und Effizienz: zwei Prioritäten
In Kontexten, in denen der Zugang zur medizinischen Versorgung eingeschränkt ist, ermöglicht die Verwendung sicherer, bekannter und oft bereits in großem Maßstab für die Veterinärmedizin hergestellter Arzneimittel:
- Entwicklungskosten senken;
- auf die bestehende Produktion angewiesen sein;
- Garantie einer bereits im Feld nachgewiesenen Wirksamkeit.
Andere Mittel gegen Parasiten, Pilzinfektionen und sogar einige Impfstoffe verfolgen ähnliche Ziele, insbesondere im Kampf gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten (NTDs), die Millionen von Menschen betreffen, aber kaum kommerzielles Interesse wecken.
Internationale Zusammenarbeit notwendig
Der Erfolg dieser Ansätze hängt von der Zusammenarbeit zwischen folgenden Akteuren ab:
- Pharmalabore (Spender oder Generikahersteller),
- internationale Gesundheitsbehörden (WHO, UNICEF),
- NGOs vor Ort (Ärzte ohne Grenzen, Carter Center),
- lokale Behörden und kommunales Gesundheitspersonal.
Diese Zusammenarbeit trägt dazu bei, die Qualität, Ethik und Logistik einer Verteilung zu gewährleisten, die an die Realitäten vor Ort angepasst ist.
Fazit: Wenn die Humanmedizin von der Tiermedizin lernt
Die Geschichte von Ivermectin und anderen ähnlichen Molekülen erinnert uns daran, dass die Grenzen zwischen Veterinär- und Humanmedizin fließend sind. Oftmals haben Entdeckungen, die ursprünglich für die Tierwelt gedacht waren, den Weg für große Fortschritte in der menschlichen Gesundheit geebnet, insbesondere im Kampf gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten.
Diese Übertragung erfolgt weder automatisch noch trivial. Sie erfordert:
- eine strenge Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit beim Menschen,
- geeignete Arzneimittelreformulierung,
- strengen regulatorischen Rahmen,
- und eine klare Kommunikation mit Fachleuten und der Öffentlichkeit, um Missbrauch zu vermeiden.
Die Verbreitung des „One Health“-Konzepts, das die Zusammenhänge zwischen der Gesundheit von Mensch, Tier und Ökosystemen anerkennt, verstärkt diesen integrierten Ansatz. Es geht nicht nur darum, vorhandene Ressourcen zu optimieren, sondern die Therapieentwicklung mit einem interdisziplinären Ansatz neu zu denken, insbesondere angesichts globaler Herausforderungen (Epidemien, Zoonosen, Antibiotikaresistenzen usw.).
Tierarzneimittel sollten für den Menschen nicht als „Produkte zweiter Klasse“ betrachtet werden, sondern bei sorgfältiger Prüfung als potenziell wertvolle Ressourcen. Der Weg von Ivermectin zeigt, dass ein gut reguliertes Produkt, das aus der veterinärmedizinischen Forschung gewonnen wird, Millionen von Menschenleben retten kann, ohne die Sicherheit oder Ethik zu gefährden.
In einer Zeit, in der in vielen Regionen der Welt weiterhin Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung bestehen, stellt diese Brücke zwischen der Gesundheit von Tieren und Menschen einen Weg für die Zukunft dar, den zu vernachlässigen eine Schande wäre.